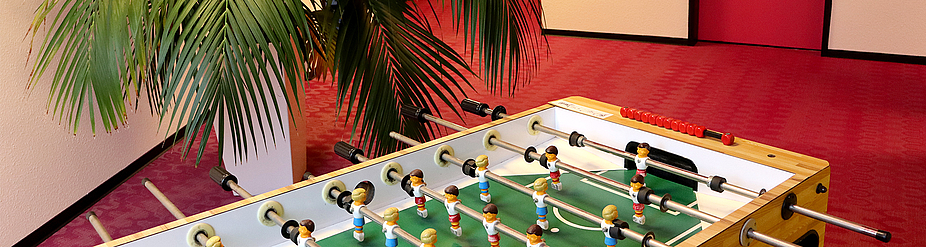Hochschulrecht / Studienplatzklage
Rechtsinfo Archiv
Studienplatzklage
Das Numerus-clausus-Urteil und seine Folgen
Das Numerus-clausus-Urteil von 1972 ist eine der wichtigsten rechtlichen Grundlagen bei der Frage der Hochschulzulassung in Deutschland. Wilhelm Achelpöhler beleuchtet das Urteil und zieht Bilanz.
Bis heute gibt es wohl keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die für das Recht auf Bildung von größeren Auswirkungen gewesen wäre als die Numerus-clausus-Entscheidung vom 18.07.1972. Dieser Entscheidung haben inzwischen Tausende Studierende ihren Studienplatz zu verdanken. Sie und die sich daran anschließende Rechtsprechung haben dem planerischen Ermessen der Universitätsbürokratie erhebliche Grenzen gesetzt, so dass es in der Folge auch nicht an Versuchen gefehlt hat, diese Rechtsprechung auszuhebeln. Die – auch für Nicht-JuristInnen lohnende – Lektüre dieses Urteils ist wie eine Zeitreise in eine bildungspolitische Vergangenheit; manches von dem, was das Bundesverfassungsgericht 1972 forderte, harrt bis heute der Verwirklichung.
Der Ausgangspunkt: Anstieg der Studierendenzahlen
Das Verfahren, an dessen Ende die erste Numerus-clausus-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stand, begann in den Jahren 1970 bzw. 1971. Es war die Zeit, in der die Erhöhung der Studierendenzahlen ein erklärtes politisches Ziel war, und die Zahl der Studienberechtigten spürbar anstieg. Das schulische Prüfungssystem ›entdeckte‹ nunmehr deutlich mehr junge Menschen, die eine ›Begabung‹ für ein Hochschulstudium aufwiesen – und entsprechend eine Hochschulzugangsberechtigung bekamen. In der Zeit von 1952 bis 1967 stieg die Zahl der Studierenden an den Hochschulen um 100 Prozent. 1967 begannen etwa 50.000 Studierende ein Studium. Das Bundesverfassungsgericht konstatierte: »Mit dieser Zunahme hielt der Ausbau der Hochschule nicht Schritt.« Die Folge aus der fehlenden Ausstattung der Hochschulen war die Einführung des Numerus clausus (NC), insbesondere für die kostenintensiven Studienplätze in der Medizin, wodurch die Zahl der StudienanfängerInnen deutlich sank. Begannen noch im Jahre 1962 7.700 Personen ein Medizinstudium, ging die Zahl im 1969 auf etwa die Hälfte zurück. Im Wintersemester 1970/71 wurden 70 Prozent der BewerberInnen um einen Medizinstudienplatz abgelehnt: 11.000 BewerberInnen standen nur 3.000 Studienplätze zur Verfügung. Diese Verhältnisse haben sich bis heute nicht verbessert, im Gegenteil: Im Wintersemester 2009/10 wurden von 37.337 BewerberInnen um einen Medizinstudienplatz nur 8.512 zugelassen, im gesamten Jahr erhielten 10.006 StudienbewerberInnen einen Studienplatz, also nur geringfügig mehr als im Jahre 1962.
Um einen Medizinstudienplatz bewarben sich zum Wintersemester 1970/71 statistisch 3,7 BewerberInnen. Dies führte zu einer breiten wissenschaftlichen Diskussion, in deren Verlauf der NC konsensual als Missstand empfunden wurde, den es zu überwinden gelte. Die westdeutsche Rektorenkonferenz hielt den NC seit einer ersten Stellungnahme vom 27.03.1968 für eine »befristete Notmaßnahme.« 1971 stellte die Rektorenkonferenz fest, dass die Vielzahl der Zulassungsrichtlinien und Termine das Zulassungswesen bis zur Lähmung behindern könne. Sie warnte davor, dass die abgewiesenen Studieninteressierten ins Ausland ausweichen und so der NC von der Bundesrepublik auf andere Staaten übergreifen könnte.
Nach Ansicht des Wissenschaftsrates konnte das Problem der Zulassungsbeschränkungen nur bundesweit gelöst werden. Der Bund hatte durch die Änderungen des Grundgesetzes (GG) in den Jahren 1969 und 1970 das Recht erlangt, Rahmenvorschriften für die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens zu erlassen, also Regelungen in einer Domäne der Länder vorzunehmen. Quasi im Ausgleich für diese Gesetzgebungskompetenz erhielt der Bund das Recht und auch die Pflicht, beim Ausbau und Neubau von Hochschulen als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern mitzuwirken, die er durch die Föderalismusreform I wieder verlor. Die Bundesregierung schlug in ihrem Bildungsbericht 1970 einen „„»5-Jahresplan zur dauerhaften Beseitigung des Numerus clausus« vor. Auch in dem Entwurf für ein Hochschulrahmengesetz wurde das Recht auf Hochschulausbildung für jedeN dazu BefähigteN betont.
Die Frage, wann das Recht auf Hochschulzugang für alle Personen mit Hochschulzugangsberechtigung verwirklicht werde, schien nur eine Frage der Zeit. MancheR, der keinen Studienplatz erhalten hatte, mochte jedoch nicht so lange warten und klagte. Zwei dieser Verfahren nahmen die Verwaltungsgerichte in München und Hamburg zum Anlass einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht. Das Verwaltungsgericht Hamburg hielt einen NC verfassungsrechtlich für bedenklich und Zulassungsbeschränkungen allenfalls als vorübergehende Maßnahme für zulässig. Der NC dürfe nicht zur ständigen Einrichtung werden und das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf freie Berufswahl aushöhlen. Da das maßgebliche Landesgesetz den NC nicht nur vorübergehend ermögliche und zudem den Staat nicht zur Schaffung ausreichender Ausbildungsplätze verpflichte, seien wegen des Fehlens einer zeitlichen Begrenzung die Regelungen über den NC verfassungswidrig, so die Argumentation der HamburgerInnen. Das Verwaltungsgericht München hielt wiederum die Regelungen des bayerischen Hochschulgesetzes für rechtswidrig, da die Ausgestaltung des Zulassungsverfahrens nicht vom Gesetzgeber selbst geregelt, sondern nahezu vollständig den Hochschulen überlassen sei.
Auch die Universität Hamburg und die westdeutsche Rektorenkonferenz pflichteten dem Verwaltungsgericht Hamburg bei. Die Regelungen über den NCs seien unzulässig, da dieser generell und zeitlich unbefristet ermöglicht werde. Der Staat sei durch das Verfassungsgebot, die Grundrechte nicht leer laufen zu lassen, verpflichtet, hinreichende Studienplätze zur Verfügung zu stellen, damit jedeR geeignete Deutsche das in Art. 12 Abs. 1 GG garantierte Recht zur freien Wahl der Ausbildungsstätte ausüben könne. Gerade dort, wo – wie bei der Ausbildung zu MedizinerInnen – der Staat über ein faktisches Ausbildungsmonopol verfüge, bestehe eine staatliche Verpflichtung zur Schaffung von Ausbildungsstätten. Zwar sei dieses Recht durch das tatsächliche Unvermögen des Staates beschränkt, Studienplätze sofort in der erforderlichen Zahl zu schaffen, »die Beschränkungen dürften sich aber weder an einem gesellschaftlich-politisch für notwendig erachteten Bedarf orientieren, da das Interesse der Studienbewerber ausschlaggebend bleiben müsse, noch dürften sie den Ausnahmecharakter einer vorübergehenden Notmaßnahme verlieren und zu einer vollständigen oder unverhältnismäßig langen Unterdrückung der Individualinteressen führen. Vielmehr müssten Vorschriften über Zulassungsbeschränkungen die Verpflichtung des Staates zur Ermittlung nachhaltig erkennbarer Studieninteressen und zur Anpassung der Kapazität durch Ausbau innerhalb bestimmter Fristen enthalten.«
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht betonte in seiner Entscheidung vom 18.07.1972, auch der Art. 12 Abs. 1 GG sei zunächst als Abwehrrecht gegen Freiheitsbeschränkungen im Ausbildungswesen konzipiert. Es verwies auf die Beratungen im Hauptausschuss des parlamentarischen Rates, wonach »unter allen Umständen« die Freiheit gesichert werden müsse, zwischen verschiedenen Universitäten zu wählen und bei »besonders hervorragenden Lehrern« hören zu können, um sich vielseitig zu bilden. Aber der Grundrechtsschutz des Art. 12 erschöpfe sich nicht in dem den Freiheitsrechten innewohnenden Schutz gegen staatliche Eingriffe. Je mehr der Staat Sozialstaat werde und sich der sozialen Sicherung und kulturellen Förderung der BürgerInnen zuwende, desto mehr trete im Verhältnis zwischen BürgerInnen und Staat neben der Freiheitssicherung das Recht auf Teilhabe an den staatlichen Leistungen. Konkretisiert auf den Hochschulzugang bedeutet dies, dass Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG und dem Sozialstaatsgebot das Recht eines jeden, die Zulassungsvoraussetzungen erfüllenden Staatsbürgers auf Zulassung zum Hochschulstudium seiner Wahl umfasse. Dazu das Bundesverfassungsgericht wörtlich:
»Die Berufsfreiheit verwirklicht sich gegenwärtig (…) vorwiegend im Bereich der privaten Berufs- und Arbeitsordnung und ist hier vornehmlich darauf gerichtet, die eigenpersönliche, selbstbestimmte Lebensgestaltung abzuschirmen, also Freiheit von Zwängen oder Verboten im Zusammenhang mit Wahl und Ausübung des Berufes zu gewährleisten. Demgegenüber zielt die freie Wahl der Ausbildungsstätte ihrer Natur nach auf freien Zugang zu Einrichtungen; das Freiheitsrecht wäre ohne die tatsächliche Voraussetzung, es in Anspruch nehmen zu können, wertlos.«
Ein Satz, der in einem bemerkenswerten Kontrast zu dem steht, was heute mit den ›Hartz-Gesetzen‹ jugendlichen Arbeitslosen zugemutet wird, die einen angebotenen Ausbildungsplatz nicht annehmen. Die frühere Bundesbildungsministerin Bulmahn (SPD) hatte erklärt, wer sich auf die Sozialhilfe verlasse, nur weil ein bestimmter Berufswunsch nicht in Erfüllung gehe, »bekommt Druck«,, und Christine Scheel stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen stellte jeder jungen Frau, die nicht Frisöse werden will, in der Bild am Sonntag vom 4.5.2003 in Aussicht: »Wer einen angebotenen Ausbildungsplatz ablehnt, dem sollte rigoros jede staatliche Unterstützung gestrichen werden.«
Recht auf Schaffung von Ausbildungskapazität?
Das Bundesverfassungsgericht vertrat in seinem Urteil die Auffassung, das Recht auf Teilhabe an staatlichen Leistungen beschränke sich auf das vorhandene Ausbildungsangebot, es bestünde demnach keine Verpflichtung zum Ausbau der Kapazitäten, wie das Verwaltungsgericht Hamburg gefordert hatte. Im Wortlaut führte das Bundesgericht zunächst aus:
»Übersteigt die Zahl der Abgewiesenen wie beim Medizinstudium sogar weit mehr als die Hälfte der Bewerber, dann droht der verfassungsrechtlich geschützte Zulassungsanspruch weitgehend leer zu laufen. Wegen dieser Auswirkungen ist nicht zu bestreiten, dass sich der absolute Numerus clausus am Rande des verfassungsrechtlich hinnehmbaren bewegt. Da diesen Auswirkungen nachhaltig nur durch Erweiterung der Kapazitäten begegnet werden kann, ließe sich fragen, ob aus den grundrechtlichen Wertentscheidungen und der Inanspruchnahme des Ausbildungsmonopols ein objektiver sozialstaatlicher Verfassungsauftrag zur Bereitstellung ausreichender Ausbildungskapazitäten für die verschiedenen Studieneinrichtungen folgt.«
Das Bundesverfassungsgericht vertieft die Frage nicht weiter, denn verfassungsrechtliche Konsequenzen ergäben sich erst bei einer »evidenten Verletzung« dieses Verfassungsauftrags. Ein solcher sei damals nicht festzustellen.
Das Verfassungsgericht schlägt dann einen Purzelbaum: »Auch soweit Teilhaberechte nicht von vornherein auf das jeweils Vorhandene beschränkt sind, stehen sie doch unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann, der bei seiner Haushaltswirtschaft auch andere Gemeinschaftsbelange zu berücksichtigen (…) hat. Bei diesen Entscheidungen werden sich die zuständigen Organe einerseits an erkennbaren Tendenzen der Nachfrage nach Studienplätzen zu orientieren haben, da eine ausschließliche Ausrichtung an den ohnehin schwierigen Bedarfsermittlungen auf eine unzulässige Berufslenkung und Bedürfnisprüfung hinauslaufen könnte, bei der die Bedeutung freier Selbstbestimmung als konstitutiven Element einer freiheitlichen Ordnung verkürzt würde. Andererseits verpflichtet ein etwaiger Verfassungsauftrag aber nicht dazu, für jeden Bewerber zu jeder Zeit den von ihm gewünschten Studienplatz bereit zu stellen und auf diese Weise die aufwändigen Investitionen im Hochschulbereich ausschließlich von der häufig fluktuierenden und durch mannigfachen Faktoren beeinflussbaren individuellen Nachfrage abhängig zu machen.«
Eine Verfassungsverletzung war also angesichts dieses Maßstabs für das Bundesverfassungsgericht nicht ersichtlich.
Gleichwohl: Das Bundesverfassungsgericht stellte strenge Hürden auf, die überwunden werden müssten, wenn der Zulassungsanspruch des Einzelnen beschränkt werden sollte. Der Zulassungsanspruch sei nur zum Schutz eines überragend wichtigen Gemeinschaftsguts und nur unter strenger Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig. Eine Zulassungsbeschränkung dürfe nur in solchen Fachrichtungen erfolgen, »wo sie wirklich notwendig ist.« Ferner müsse vor deren Einführung geprüft werden, ob die Universität andere schonendere Maßnahmen »vor allem auf dem Gebiet der Studienreform« treffen kann. Der NC sei unzulässig, »wenn der Engpass durch gezielten Einsatz sachlicher und personeller Mittel bis hin zu Parallelveranstaltungen, der Verteilung von Pflichtveranstaltungen auf mehrere Semester oder der Einrichtung von Ferienkursen behebbar wäre und dadurch die Zahl der zuzulassenden Bewerber erhöht werden könnte.«
Der NC sei nur verfassungsmäßig, wenn er in den Grenzen des unbedingt erforderlichen und der erschöpfenden Nutzung der vorhandenen, mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Ausbildungskapazitäten angeordnet werde und wenn Auswahl und Verteilung nach sachgerechten Kriterien mit einer Chance für jedeN an sich hochschulreifeN BewerberIn und unter möglichster Berücksichtigung der individuellen Wahl des Ausbildungsortes erfolge. Die Berechnung der Kapazität sei normativ festzulegen, sie stelle keinen »von rein tatsächlichen Gegebenheiten – wie Personal-, Raum- und Mittelbestand, Bettenzahl und Studienverhalten – abhängige empirische Größe« dar.
Fortführung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung infolge dieser ersten Grundsatzentscheidung in zahlreichen weiteren Entscheidungen konkretisiert. So entschied es, dass verfassungsrechtlich auch eine Teilzulassung im Studiengang Humanmedizin ermöglicht werden müsse. Ferner hat es darauf hingewiesen, dass Klagen auf Zulassung von Studienplätzen nicht schon wegen der ungünstigen Rangziffer (Note) der klagenden BewerberInnen abgewiesen werden dürfen. Es hat den Quereinstieg gesichert, den erschwerten Zugang der ZweitstudiumsbewerberInnen gebilligt und nahm Stellung zur Wartezeit für den Zugang zum Hochschulstudium, die im Jahre 1976 bei bis zu 7 Jahren lag. Ferner forderte das Bundesverfassungsgericht die Fachgerichte zu einer umfassenden Prüfung der Kapazitäten und der sie begründenden Normen auf.
Heute
Die Bilanz könnte heute kaum ernüchternder sein: Der NC ist zu einer Dauereinrichtung geworden und gilt inzwischen in nahezu allen Fächern. Die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen trug ebenso zu einem Zulassungswirrwarr bei wie die politisch begründete Zerschlagung der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS). Auch von einem Ausbau der Hochschulen kann keine Rede sein. In NRW wurden zwischenzeitlich 40 Prozent der Medizinstudienplätze abgebaut, andere Bundesländer gehen ähnlich vor. Gleichzeitig wird durch die Einführung von Auswahlverfahren bei der Studienzulassung das Abitur als Grundlage der Hochschulzulassung entwertet. In den künstlerischen Studiengängen wird mit der Aufnahmeprüfung bereits heute vorgemacht, wie das »Recht eines jeden Befähigten auf ein Hochschulstudium seiner Wahl« auch verwirklicht werden kann: Dort bestehen die Aufnahmeprüfung meist nur genauso viele BewerberInnen, wie es festgesetzte Studienplätze gibt – die Anzahl der durch die Hochschule bestimmten Befähigten trifft also genau auf die Anzahl der durch eben diese Hochschule festgelegten Studienplätze. Prozesse um die Ausschöpfung von Kapazitäten gibt es in diesen Fächern kaum.
Wilhelm Achelpöhler, geb. 1961, ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit dem Schwerpunkt Hochschulrecht in Münster. Er vertritt unter anderem KlägerInnen bei Verfahren zur Zulassung an eine Hochschule.
Das Studienheft 6 Menschenrecht auf Bildung kann bezogen werden beim BdWi-Verlag Gisselberger Str.7 35037 Marburg verlag[at]bdwi.de Preis: 8,- EUR
Münster, 16.12.2009